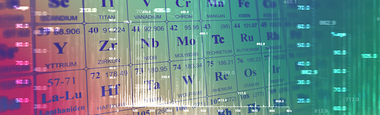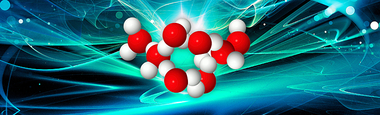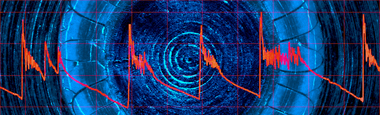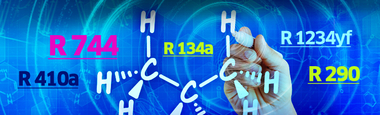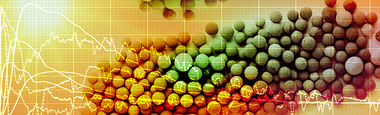Aktuelle Forschungsprojekte
Sie befinden sich hier: / Startseite
Studentische Arbeiten in der Klimatechnik
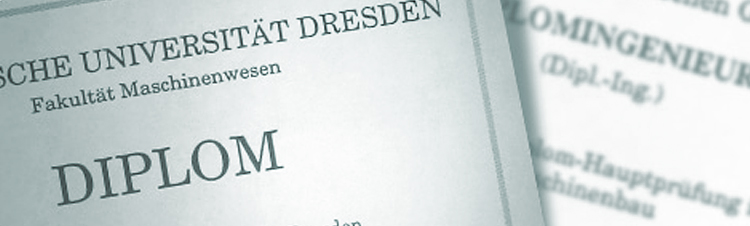
Praktikum, Diplom, Master, Bachelor
Übersicht der Themenangebote
- Akustikbasierte Regelung einer Klimaanlage
- Experimentelle Untersuchung an einem Thermosyphon
- Superresolution-Methoden für Raumluftströmungen
- Sorptionskreislauf mit Zeolithen zur Energiespeicherung
- Analysen an Mikro-Environments (Mue)
- Indoor Environment Quality (IEQ)
- Untersuchungen an einem Kaltwasser-Schichtenspeicher
- Hilfsmittel für den rationellen Planungsprozess
- Entwicklung einer Wetterschutzhaube mit integrierter Kühlung auf Basis der indirekten Verdunstung
- Entwicklung eines neuen Ventilators für dezentrale Push-Pull-Lüftungssysteme
- Entwicklung eines Außenwand-Bauelements für die universelle Integration dezentraler Lüftungsgeräte
- Ermittlung klimatischer Regionen für die Gebäudesimulation mittels Clustering-Verfahren
- Berechnung von Kennzahlen für Fensterkombinationen in der Gebäudesimulation
- Web-App für Darstellung der Zustände und Prozesse feuchter Luft
- Automatisierung der Auswertung von Schallleistungsmessungen
- Mobiler Prüfstand und Auswertungssoftware für Dichtheitsmessungen (Blower-Door)
Akustikbasierte Regelung einer Klimaanlage
Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wird an der Entwicklung einer akustikbasierten Regelung für Klimaanlagen gearbeitet. Die Motivation dafür ist die Tatsache, dass Unterrichts- und Seminarräume in Schulgebäuden/ Bildungsbauten durch eine hohe Belegungsdichte mit Personen gekennzeichnet sind. Zur Sicherstellung der Anforderungen an die Raumlufthygiene ist ein hoher Luftwechsel notwendig, wofür Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingesetzt werden.
In Schulgebäuden sind Lüftungsanlagen nicht Standard. Im Sanierungsfall könnten dezentrale Anlagen kostengünstig nachgerüstet werden. Jedoch führen dezentrale Anlagen sehr oft zu Lärmbelastung.
Zielstellung des Forschungsvorhabens ist die Entwicklung eines Regelalgorithmus zur Steuerung der Ventilatoren bzw. der Luftmenge von RLT-Anlagen, welcher durch die momentane akustische Situation im Klassenraum geführt wird.
Für die studentische Arbeit werden Teilaufgaben aus dem Forschungsvorhaben herausgelöst, welche sich am aktuellen Bearbeitungsstand orientieren. Die folgenden Themenschwerpunkte stehen zur Verfügung:
- Akustische Datenerhebung zu typischen Schulstunden, Datenanalyse und Klassifizierung,
- Akustik - KI Modellentwicklung zur maschinellen Datenanalyse, Training, Entwicklung der Regelstrategie,
- Aufbau eines repräsentativen Klassenraums im Labor, psychoakustische Untersuchungen im Labor zum Störempfinden,
Entwicklung eines digitalen Zwillings zur Simulation von Unterrichtsszenarien, Simulation von Unterrichtszenarien/ Datenbeschaffung zum Training der KI-Modelle
Betreuer: Dr.-Ing. Ralph Krause
Experimentelle Untersuchung an einem Thermosyphon
An der ILK Dresden gGmbH existiert ein Thermosyphon zur Untersuchung des Einflusses von Suspensionen als Arbeitsmedium. Der Thermosyphon ist aus einem Verdampfer, einer adiabaten Sektion und einem Kondensator modular zusammengesetzt. Zur Erhebung von Messdaten ist das System mit 5 Druck- und 12 Temperatursonden versehen. Zudem werden die Sekundärkreise mit Volumenstrommessgeräten zur Bestimmung der übertragenen Wärme ausgestattet.
Die Teilaufgaben der studentischen Arbeit sind:
1. Experimentelle Untersuchung von strukturierten Verdampferoberflächen eines Thermosyphons. Die Strukturierung wird durch Einlegen von metallischen Geweben erzeugt.
2. Vergleichende Darstellung der Messergebnisse. Photographische und mikroskopische Untersuchungen der inneren Verdampferoberflächen. Die Untersuchungen sind vor und nach den Versuchen durchzuführen.
3. Vergleich der Messergebnisse mit vorliegenden Referenzmessungen für einen unstrukturierten Verdampfer.
4. Ausfertigung der schriftlichen Arbeit inklusive Diskussion der Ergebnisse.
Die Betreuung und technische Unterstützung der Arbeit erfolgt durch die Mitarbeiter der ILK Dresden gGmbH unter Federführung von
PD Dr. Ing.-habil. M.H. Buschmann
Superresolution-Methoden für Raumluftströmungen
Die Simulation von Raumluftströmungen mithilfe numerischer Strömungsmechanik (CFD) ist ein zentrales Werkzeug in der Klimatechnik. Allerdings sind hochaufgelöste Simulationen sehr rechenintensiv. Methoden der Superresolution eröffnen die Möglichkeit, aus grob aufgelösten Simulationen feinere Strömungsstrukturen mit Hilfe von Maschinenlernverfahren (z.B. Autoencoder, Convolutional neural network CNN) zu rekonstruieren. Dies könnte die Berechnungseffizienz deutlich verbessern und neue Anwendungsfelder eröffnen.
Im Rahmen dieser Arbeit sollen mithilfe einer Literaturrecherche frei verfügbare Python-Codes für Strömungsfeld- Superresolution identifiziert werden. Der meistversprechende Code soll nachvollzogen und auf zu diesem Zweck generierte CFD-Daten für Raumluftströmungen angewendet und systematisch getestet werden. Dabei können verschiedene Einflussgrößen (z.B. Vergrößerungsfaktor, Reynolds-Zahl der Strömung) variiert und deren Auswirkung auf die Ergebnisqualität untersucht werden.
Für die Durchführung der Arbeit sind Programmierkenntnisse sowie Grundkenntnisse in numerischer Strömungsmechanik (CFD) und Strömungslehre erforderlich. Der Umfang und die konkrete Ausrichtung der Arbeit können angepasst werden.
Betreuer: Dr.-Ing. Thomas Oppelt
Sorptionskreislauf mit Zeolithen zur Energiespeicherung
Zeolithe in Form von Schüttungen können als thermischer Energiespeicher in diskontinuierlichen Prozessen eingesetzt werden, indem sie mittels Wärmezufuhr aufbereitet (thermisch beladen) werden. Ihren Nutzen entfalten sie innerhalb eines bspw. chemischen oder physikalischen Prozesses, bei dem sie bspw. gezielt Feuchtigkeit aufnehmen und dabei auch Wärme wieder abgeben. Potentielle Anwendungen können Trocknungsprozesse, bspw. in Schwimmbädern oder in der Industrie sein.
Ein derartiges neues zeolithbasiertes System benötigt einen Transportmechanismus sowie strömungstechnische, optimierte, mechanisch miteinander verbundene Bauelemente mit bedarfsgerecht ausgelegten geometrischen Abmessungen.
Im Rahmen studentischer Arbeiten sind konzeptionelle Studien hinsichtlich Konstruktion und strömungsrelevanten Eigenschaften Zeolith-transportierender Bauteile durchzuführen.
Eine konkrete Aufgabenstellung wird dem aktuell vom Bewerber erreichten Semester (Praktikum, Bachelor, Master etc.) angepasst.
Betreuer: Dipl.-Ing. (FH) Hannes Rosenbaum
Analysen an Mikro-Environments (Mue)
Sogenannte Mikro-Environments (Mue) gelten als neuartiger Ansatz zur Klimatisierung von Aufenthalts- und Arbeitsbereichen von Menschen. Dabei werden mittels lokaler, dezentral positionierter Klein(st)geräte nur diejenigen relevanten Raumbereiche lokal und unter Berücksichtigung thermischer Behaglichkeitskriterien klimatisiert, in denen sich Menschen aufhalten. Miko-Environments nutzen im Kern bspw. kleine Kompressionskälteprozesse zum Kühlen von Luft (um lokal Raumluft abzukühlen und einer Person zuzuführen) oder Wasser (um eine gekühlte Fläche für den Strahlungsaustausch mit einer Person zu erzeugen).
Im Rahmen studentischer Arbeiten können wahlweise folgende Variantenuntersuchungen durchgeführt werden: Visualisierung der Strömung innerhalb der Mikroenvironments (experimentell); thermische Behaglichkeit und Akustik (experimentell); konstruktive Umsetzung (experimentell); Regelung (experimentell); Energieversorgungs- und Energiespeicherkonzepte (theoretisch/ numerisch).
Eine konkrete Aufgabenstellung wird dem aktuell vom Bewerber erreichten Semester (Praktikum, Bachelor, Master etc.) angepasst.
Betreuer: Dipl.-Ing. (FH) Hannes Rosenbaum
Indoor Environment Quality (IEQ)
Hauptaspekte der Indoor Environment Quality sind thermische Behaglichkeit, Luftqualität, visueller Komfort und akustische Behaglichkeit. In die Bewertung der IEQ fließt folglich eine Vielzahl von Messgrößen ein, die i.d.R. nicht von einem gemeinsamen Messsystem erfasst werden. Darüber hinaus gelten für die unterschiedlichsten Aufenthaltsorte von Personen (Industrie, Wohnungsbau, Büros, Verkehrsmittel, Außenbereich) auch unterschiedlichste Anforderungen.
Im Rahmen einer studentischen Arbeit soll ein bestehendes Messkonzept für die thermische Behaglichkeit nach DIN EN ISO 7730 überarbeitet und weitergedacht werden. Ziel ist es, die Vielzahl potentieller Aufenthaltsorte von Personen, beginnend mit der thermischen Behaglichkeit analysieren und bewerten zu können. Hinsichtlich der Auswertemethoden sind die jeweiligen Anforderungsprofile zu berücksichtigen. Darüber hinaus soll das erweiterte Messkonzept auch Aspekte der visuellen und der akustischen Behaglichkeit enthalten. Der Umfang und die konkrete Ausrichtung der Arbeit können angepasst werden.
Betreuer: Dipl.-Ing. (FH) Hannes Rosenbaum
Untersuchungen an einem Kaltwasser-Schichtenspeicher
Eine selbsttägige dichteabhängige Speicherbeladung in verschiedene Speicherhöhen, wie sie bei Wärmespeichern genutzt wird, ist bei Kaltwasserspeichern aufgrund der geringen Dichteunterschiede zwischen Kaltwasservor- und –rücklauf nicht möglich. Daher wurde im ILK Dresden ein aktives Be- und Entladesystem für Kaltwasser-Pufferspeicher entwickelt, welches durch eine aktive temperaturgesteuerte Einschichtung des Kaltwassers in verschiedene Speicherhöhen ermöglicht und konvektive Mischungseffekte weitgehend vermeidet.
Für dieses Speicherkonzept ist eine Steuerung in den Versuchsstand zu implementieren und zu testen. Die Steuerung, die auch Effizienzinformationen verschiedener Kälteerzeuger enthält, soll die temperaturabhängige Ansteuerung der Beladeeinrichtung übernehmen. Üblicherweise würde der Kälteerzeuger bei Überschreiten einer definierten Temperatur am Speicherkopf durch eine übergeordnete Regelung (GLT) freigegeben und mit Nennleistung in Betrieb gesetzt. Durch die Integration der Leistungskennlinie des verwendeten Kälteerzeugers soll die Steuerung die Kältemaschine gezielt auch mit geringerer Leistung anfordern. Die höhere Effizienz bei Teillast (z.B. 50 % der Nennleistung) kann so bei mehrstufigen oder drehzahlgeregelten Verdichtern gezielt genutzt werden, um Energie bei der Kälteerzeugung einzusparen. Bei der studentischen Arbeit stehen vor allem praktische Versuche am Versuchsstand im Vordergrund. So sind verschiedene Messreihen geplant, bei denen der Speicher aktiv beladen wird und die Qualität der Temperaturschichtung messtechnisch erfasst und ausgewertet werden soll. Der inhaltliche und zeitliche Umfang und die konkrete Ausrichtung der Arbeit können angepasst werden.
Betreuer: Dipl.-Ing. Ronny Mai
Hilfsmittel für den rationellen Planungsprozess
Bei Planungswettbewerben und im laufenden Planungsprozess gebäudetechnischer Anlagen müssen frühzeitig kaufmännische Vorkalkulationen in der Regel auf Basis spezifischer Kenngrößen erstellt werden.
Statistisch werden daher aus Projekten vieler verschiedener Planungsbüros aktuelle Kostenkennwerte ermittelt. Aus diesem Grund berücksichtigen diese zentral aufbereiteten Kostenkennwerte keine individuellen Planungslösungen einzelner Projekte.
Im Rahmen eines Praktikums sollen vorliegende Daten abgeschlossener und laufender Projekte analysiert und so aufbereitet werden, dass mit einem einfachen Softwaretool auf Basis üblicher Office-Software schnelle zuverlässige Kostenschätzungen möglich werden. Die Datenbank soll zudem einfach fortzuschreiben oder zu pflegen sein.
Betreuer: Ralph Rogge
Entwicklung einer Wetterschutzhaube mit integrierter Kühlung auf Basis der indirekten Verdunstung
Dezentrale Push-Pull-Lüftungsgeräte haben auf der Außenseite sogenannte Wetterschutzhauben. In eine solche Wetterschutzhaube soll eine Kühlfunktion integriert werden. Das hierfür vorgesehene Funktionsprinzip ist die indirekte Verdunstung. Das dabei entstehende Kühlpotential soll für eine Abkühlung der warmen Außenluft im Sommer genutzt werden.
Die dafür infrage kommenden technischen Lösungsansätze führen zu neuen Designs von Wetterschutzhauben. Als wassertragende Struktur sind spezielle technische Textilien geplant. Diese müssen mit einem sehr effizienten Wärmeübertragersystem verbunden werden. Die technischen Stoffe werden mit (weichem) Wasser benetzt. Je nach Außenluftzustand verdunstet das Wasser in dieser Struktur. Die Menge des verdunsteten Wassers muss entsprechend nachdosiert werden.
Für diese beschriebenen technischen Anforderungen sollen Modelluntersuchungen entwickelt und durchgeführt werden sowie konstruktive Lösungsansätze für das Wärmeübertragersystem und die Wasserdosierung entwickelt werden.
Diese Entwicklung kann im Rahmen einer studentischen Arbeit durchgeführt werden. Sie erfordert Grundkenntnisse auf dem Gebiet der Mechanik, Wärme- und Strömungstechnik.
Betreuer: M.Sc. Rebekka Grüttner und Dr.-Ing. Karsten Hackeschmidt
Entwicklung eines neuen Ventilators für dezentrale Push-Pull-Lüftungssysteme
Es gibt eine Vielzahl an alternierend arbeitenden, dezentralen Lüftungsgeräten. Die Geräte sind sehr einfach im Aufbau und bestehen aus den Komponenten Wandeinbauhülse, Innenblende, Axialventilator, Wärmespeicher und Wetterschutzhaube. Der Axialventilator ist so gestaltet, dass er in beiden Drehrichtungen betrieben werden kann. Mit der Drehrichtungsänderung ändert der Ventilator die Förderrichtung. Diese Ventilatoren sind sehr empfindlich bei Druckschwankungen (Windeinfluss).
Es soll ein neuer Ventilator entwickelt werden, der mittels variabler Laufschaufeleinstellung im Betrieb die Förderrichtung und Luftmenge ändern kann. Die Änderung der Förderrichtung soll nicht mehr durch eine Änderung der Drehrichtung erfolgen. Zusätzlich soll er druckstabiler werden. Diese Neuentwicklung beinhaltet Modelluntersuchungen, Designstudien und die Erarbeitung mechanischer Lösungen für die Änderung der Laufschaufelstellung.
Diese Entwicklung kann im Rahmen einer studentischen Arbeit durchgeführt werden. Sie erfordert Grundkenntnisse auf dem Gebiet der Strömungstechnik, der Mechanik und dem 3D-Druck.
Betreuer: Dr.-Ing. Karsten Hackeschmidt
Entwicklung eines Außenwand-Bauelements für die universelle Integration dezentraler Lüftungsgeräte
Aktuell werden dezentrale Lüftungsgeräte nachträglich in oder an Außenwänden installiert. Alle erforderlichen Öffnungen für die Luftströme (Außen-, Fort-, Ab- und Zuluft) öffnen für spezielle Geräteausführungen die Außenwand und deren Dämmung. Noch größer wird der Aufwand, wenn aus akustischen Gründen Kanalelemente verbaut werden sollen.
Ein neuer Lösungsansatz soll dahingehend entwickelt werden, dass eine universelle Einbauumgebung für dezentrale Lüftungsgeräte als Bauelement in Außenwänden mit verbaut wird. In dieser können dann unabhängig vom Baufortschritt die Komponenten von dezentralen Lüftungsgeräten eingebaut und gewartet werden. Diese Flexibilität erhöht auch die Freiheitsgrade für die Optimierung technischer Eigenschaften (Leistung und Akustik). Diese Neuentwicklung beinhaltet Modelluntersuchungen, Designstudien und Leistungsmessungen in Abhängigkeit von Komponentenanordnungen.
Diese Entwicklung kann im Rahmen einer studentischen Arbeit durchgeführt werden. Sie erfordert Grundkenntnisse auf dem Gebiet der Mechanik, Konstruktion, Strömungstechnik und Akustik.
Betreuer: Dr.-Ing. Karsten Hackeschmidt
Ermittlung klimatischer Regionen für die Gebäudesimulation mittels Clustering-Verfahren
Für die Gebäudeberechnung existieren verschiedene klimatische Einteilungen Deutschlands, etwa drei Kühllastzonen nach VDI 2078 zur Kühllastauslegung oder zwölf Testreferenzjahr-Regionen zur Energiebedarfsberechnung. Diese Einteilungen beruhen auf Datenauswertungen, die über 30 Jahre zurückliegen. Heute stellt der Deutsche Wetterdienst umfangreiche Datensätze online bereit, darunter quadratkilometergenaue Testreferenzjahre mit stündlichen Werten. Diese Daten ermöglichen es, auf Basis moderner Methoden neue, objektive Regionseinteilungen zu entwickeln.
Im Rahmen dieser Arbeit sollen Kenngrößen (z. B. Jahresmitteltemperatur, Extremwerte, Anzahl der Frosttage) definiert und mittels Berechnungsskript automatisiert für eine große Anzahl von Standorten bestimmt werden. Darauf basierend sollen die Standorte mit Methoden des maschinellen Lernens (Clustering) zu neuen Klimaregionen zusammengefasst werden. Dabei sollen verschiedene Clustering-Verfahren getestet, die Anzahl der Cluster variiert sowie unterschiedliche Betrachtungszeiträume (ganzjährig, Sommer, Winter) analysiert werden. Ziel ist es, eine belastbare und nachvollziehbare alternative Regionseinteilung für die Gebäudesimulation und TGA-Auslegung abzuleiten.
Für die Durchführung der Arbeit sind Programmierkenntnisse (vorzugsweise in Python, z. B. mit der Bibliothek scikit-learn) erforderlich. Kenntnisse in Statistik sind von Vorteil. Der Umfang und die konkrete Ausrichtung der Arbeit können angepasst werden.
Betreuer: Dr.-Ing. Thomas Oppelt
Berechnung von Kennzahlen für Fensterkombinationen in der Gebäudesimulation
Die Kombination von Verglasungen und Sonnenschutzeinrichtungen hat einen entscheidenden Einfluss auf den Energiebedarf und den thermischen Komfort in Gebäuden. Zur Beschreibung dieser Bauteile bietet die Richtlinie VDI 6007 Blatt 2 einen Algorithmus, nach dem sich relevante Kennzahlen (z. B. Gesamtenergiedurchlassgrad, Wärmedurchgangskoeffizient) berechne lassen.
Im Rahmen dieser Arbeit soll zunächst eine Einarbeitung in den Algorithmus nach VDI 6007 Blatt 2 erfolgen. Anschließend soll ein vorhandenes Visual-Basic-Programm in Python umgesetzt und so erweitert werden, dass Fensterkombinationen mit einer beliebigen Anzahl an Schichten (bisher maximal drei) abgebildet werden können. Außerdem sollen typische Produktdaten von Verglasungen und Sonnenschutzeinrichtungen recherchiert und für Beispielrechnungen herangezogen werden. Dabei kann unter anderem die Sonnenschutzposition (innen, außen) variiert werden.
Für die Durchführung der Arbeit sind grundlegende Programmierkenntnisse erforderlich. Kenntnisse in Wärmeübertragung sind von Vorteil. Der Umfang und die konkrete Ausrichtung der Arbeit können angepasst werden.
Betreuer: Dr.-Ing. Thomas Oppelt
Web-App für Darstellung der Zustände und Prozesse feuchter Luft
In der Klimatechnik werden die Zustände und Zustandsänderungen feuchter Luft und Prozesse, wie sie z.B. bei der Aufbereitung in der Prozesslufttechnik auftreten gerne im h,x-Diagramm (Mollier-Diagramm) dargestellt.
Basierend auf bereits vorhandenen Berechnungsbibliotheken und ersten Ansätzen ist die Aufgabe, eine interaktive App für die Eingabe und Darstellung dieser Informationen im Internet zu entwerfen. Dabei sind die notwendige Architektur zu entwickeln, die UI/UX-Elemente und Konzepte festzulegen und das Programm zu schreiben. Die Programmiersprache kann z.B. Python, C#, C++, Rust, Java oder eine geeignete Kombination unterschiedlicher Sprachen sein. Ein Inhouse-Server für das Testen der Anwendung ist vorhanden.
Betreuer: Dipl.-Ing. (FH) Christian Friebe
Automatisierung der Auswertung von Schallleistungsmessungen
Das ILK Dresden ist mit akustischer Messtechnik breit aufgestellt. Im Rahmen dieser Arbeit soll ein automatisiertes Verfahren zur Auswertung von Schallleistungsmessungen im Hallraum entwickelt werden. Ziel ist es, die vorhandenen Messdaten strukturiert einzulesen, die relevanten akustischen Kenngrößen zu berechnen und daraus automatisch ein Messprotokoll zu erzeugen. Schallleistungsmessungen sind ein zentrales Instrument zur Beurteilung und Vergleichbarkeit von Geräuschquellen und bilden damit eine wichtige Grundlage für Forschung, Produktentwicklung und Qualitätssicherung.
Am Institut wurden bereits erste Vorarbeiten zur teilautomatisierten Datenauswertung und Berichtserstellung durchgeführt, auf denen im Rahmen dieser Arbeit gezielt aufgebaut werden kann. Die Arbeit bietet einen praxisnahen Einblick in die ingenieurstechnische Versuchsdurchführung und Datenauswertung und eignet sich für ein Praktikum oder eine Bachelorarbeit. Neben einem Grundverständnis der Akustik und Messtechnik sind grundlegende Programmierkenntnisse (z. B. in Python) hilfreich, können jedoch im Verlauf der Arbeit mit entsprechender Einarbeitungszeit erworben werden. Ziel ist ein funktionales, erweiterbares Tool, das im Forschungsbetrieb des Instituts zukünftig regelmäßig eingesetzt werden kann.
Betreuer: Dipl.-Ing. Timo Eichenhardt
Mobiler Prüfstand und Auswertungssoftware für Dichtheitsmessungen (Blower-Door)
Ziel dieser Arbeit ist die Konzeption und der Aufbau eines mobilen Prüfstands zur Durchführung von Dichtheitsmessungen an/in Gebäuden, ergänzt um eine selbst zu entwickelnde Auswertungssoftware. Der Prüfstand soll die Messung von Differenzdruck und Volumenstrom ermöglichen, robuste Schnittstellen zu Sensorik/Antrieb bieten und ein sicheres, mobil einsetzbares Setup (Stromversorgung, Verkabelung, Schutzgehäuse) umfassen. Auf Softwareseite sind Datenerfassung, Plausibilitäts-prüfungen, Visualisierung der Messreihen sowie eine automatische Protokollgenerierung vorgesehen; optional können Kalibrier- und Unsicherheitsabschätzungen integriert werden. Einzelne Teilaspekte (z. B. nur Hardware-Design oder nur Software) können – je nach Interesse – auch separat bearbeitet werden.
Die Arbeit eignet sich für ein Praktikum oder eine Bachelorarbeit und spricht besonders Studierende der Gebäudetechnik, des Maschinenbaus oder verwandter Studiengänge an. Grundkenntnisse in Messtechnik und Interesse an praktischer Umsetzung sind hilfreich; Programmierkenntnisse (z. B. Python) sind wünschenswert, aber nicht zwingend – die notwendigen Fertigkeiten können im Rahmen der Arbeit aufgebaut werden. Ziel ist ein praxistauglicher Prüfstand mit nutzerfreundlicher Auswertung.
Betreuer: Dipl.-Ing. Timo Eichenhardt
Ihre Anfrage zum Projekt
Weitere Projekte
CaptureTest – Erfassungsgrad von Absaugern für Kochdünste
Entwicklung eines Prüfverfahrens für den Erfassungsgrad von Dunstabzügen
Neues sorptives Entfeuchtungssystem mit Energiespeicherung mit Naturmaterial - SEENaM
Lufttrocknung als Demand-Response-System grüner Stromerzeugung
Strahltechnikentwicklung mit Wassereis-Strahlmittel
Nachhaltiger, kontaminationsfreier Prozess für Medizin und Industrie
StellarHeal – Wound Healing in Space and on Earth
Ein disruptives Wundbehandlungskonzept für die Raumfahrtmedizin
Matrix-Design for Artificial Meat (MADAM)
Wirtschaftlich konkurrenzfähige Steaks aus dem Zellkulturlabor