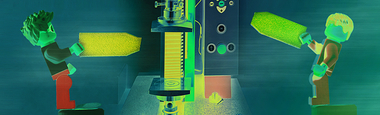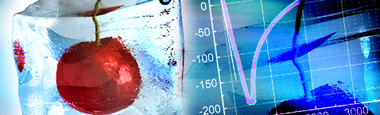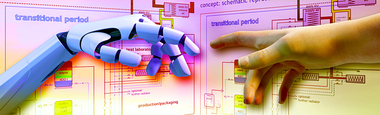Die Dekarbonisierung des Wärmesektors gilt als eine der größten Herausforderungen der Energiewende. Während im Strombereich der Ausbau erneuerbarer Quellen weit vorangeschritten ist, hinkt die Wärmeversorgung noch immer hinterher – sie ist in Deutschland für über 50 % des Endenergieverbrauchs verantwortlich. Umso bedeutender ist es, skalierbare, klimafreundliche Alternativen zu fossilen Heizsystemen zu identifizieren und zu etablieren. Eine dieser Alternativen rückt zunehmend in den Fokus von Stadtwerken, Planern und Kommunen: die Kalte Nahwärme oder sogenannte kalte Netze. Technisch basiert Kalte Nahwärme auf einem Niedertemperatur-Nahwärmenetz, das Umweltwärmequellen wie Erdwärme, Grundwasser, Abwärme oder auch solare Einspeisung nutzt – typischerweise bei Vorlauftemperaturen zwischen 8 und 20 °C.
Flexibilität ist das Stichwort:
Im Prinzip kann nahezu jede Abwärmequelle eingebunden werden, wenn das Temperaturniveau im Kreislauf niedrig ist. Noch größer kann der Nutzen auf der Verbraucherseite sein: Die Wärme wird dezentral über Wärmepumpen in den Gebäuden auf das benötigte Temperaturniveau gebracht. Damit können auch Gebäudeansammlungen unterschiedlicher wärmetechnischer Standards versorgt werden. Durch die niedrige Netztemperatur entstehen kaum Verteilverluste, und der Wärmebedarf kann bedarfsgerecht und hocheffizient gedeckt werden. Ob kalte Netze wirtschaftlich sinnvoll sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bei einer städtischen Bebauung ist vermutlich die klassische Fernwärme erfolgreich. Weit außerhalb der Städte überwiegen sicherlich Einzelsysteme. Dazwischen kann bei einer ausreichenden Dichte an Anbietern und Abnehmern von Kalter Nahwärme ein wirtschaftlich interessantes Stadtgebiet erschlossen werden. Planerisch eröffnet diese Systemtrennung zwischen Erzeugung und Übergabe neue Flexibilität: Kalte Nahwärme erlaubt sektorübergreifende Lösungen mit PV-Strom, Eisspeichern, regenerativer Rückkühlung und saisonaler Zwischenspeicherung. Gleichzeitig ermöglicht sie durch modulare Struktur eine einfache Integration in Bestandsquartiere sowie eine zukunftssichere Versorgung für Neubaugebiete. Mit der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und der kommunalen Wärmeplanung, wie sie etwa im Wärmeplanungsgesetz (WPG) verankert ist, nimmt die Kalte Nahwärme zunehmend eine Schlüsselrolle ein.
In Deutschland entstehen derzeit erste Projekte mit kalten Netzen.
Dabei zeigt sich, wie durch frühzeitige Einbindung der Akteure – von Netzbetreibern über Wohnungsbaugesellschaften bis zu den Bürgerinnen und Bürgern – tragfähige Modelle entstehen, die Technik, Wirtschaftlichkeit und Akzeptanz vereinen. Die entscheidende Frage wird sein, wer die kalten Netze betreiben soll. Sind es die Fernwärmeversorger,
die schon jetzt wegen der Preispolitik in der Kritik stehen, oder werden andere Akteure den Markt übernehmen? Wird es einen Anschlusszwang geben oder überlässt
man die Entscheidung den einzelnen Gebäudeeigentümern? Wie sieht es mit der Versorgungssicherheit aus, wenn scheinbar sichere Abwärmequellen aus
technischen Gründen nicht verfügbar sind? Muss der Netzbetreiber eine ausreichende Redundanz vorhalten?
Nicht zuletzt ist auch ein Preismodell gefragt, welches sowohl für Einspeiser als auch für Entnehmer attraktiv ist! Aus Sicht der Wärmepumpen sind die kalten Netze eine wichtige Komponente. Setzen wir uns dafür ein, dass die kalten Netze in den Fokus der Wärmeplanung kommen!
Lesen Sie gerne mehr im KI-Portal.
Ihr Prof. Dr.-Ing. Uwe Franzke
Herausgeber